Sie sind hier:
Sinn einer Verfügung von Todes wegen ist es grundsätzlich, den oder die Erben zu bestimmen und damit die gesetzliche Erbfolge zu vermeiden oder zu modifizieren. Darüber hinaus kann der Erblasser verschiedene weitere Anordnungen treffen.

Im Testament trifft der Erblasser rechtsgeschäftliche Anordnungen
Das Testament stellt als letztwillige Verfügung eine Art einer Verfügung von Todes wegen dar. Sinngemäß bedeutet das Wort „Testament“ Zeugnis. Es ist eine einseitige, formbedürftige Willenserklärung des Erblassers über den Umgang mit seinem Nachlass im Falle seines Todes.
Wurde nicht allen Formalien durch den Erblasser oder ggf. einen Notar bei der Testamentserstellung Genüge getan, ist das Testament ungültig.
Das eigenhändige Testament muss vom Erblasser höchstpersönlich geschrieben und unterzeichnet werden. Die Besonderheiten hierzu finden sich in § 2247 BGB und können auch vom juristischen Laien verständlich nachgelesen werden. Im Zeitalter der Computertechnik sei noch angemerkt, dass das eigenhändige Testament zwingend handschriftlich zu errichten ist. Es ist also nicht ausreichend, das Testament „eigenhändig“ am Computer zu schreiben, es dann auszudrucken und zu unterzeichnen. Insofern soll eine höhere Fälschungssicherheit erreicht werden.
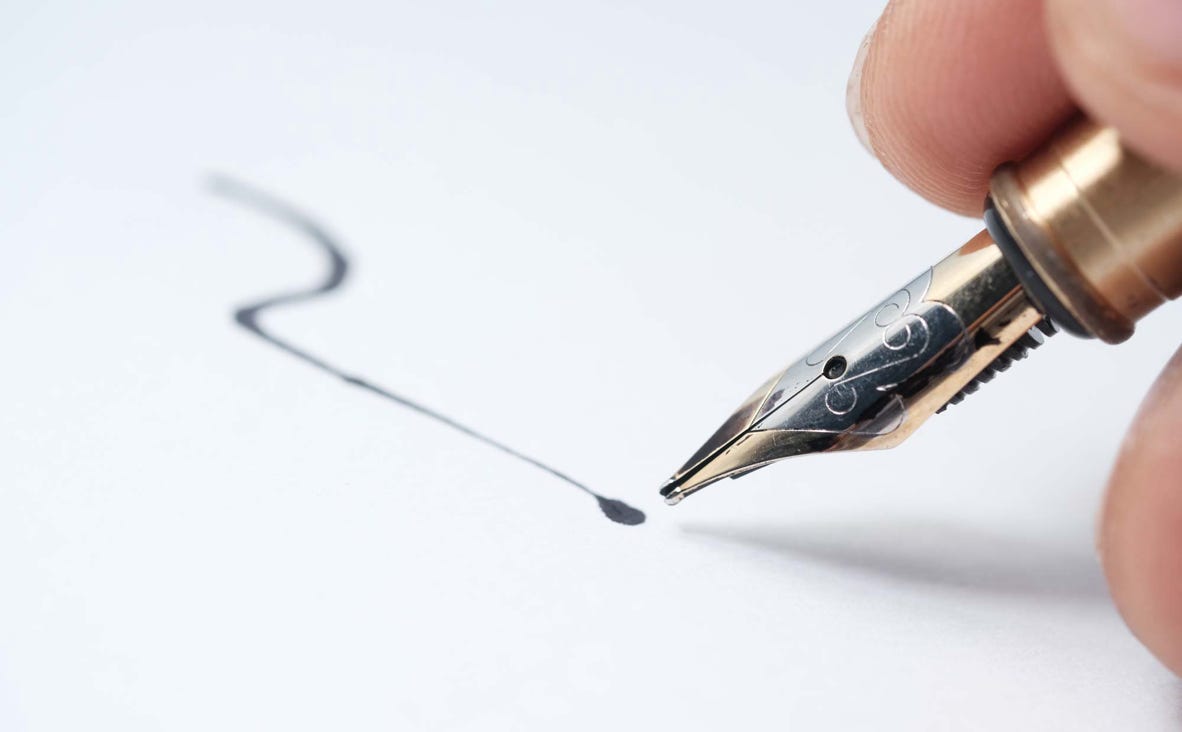
Neben dem eigenhändigen Testament gibt es das öffentliche Testament, welches zur Niederschrift eines Notars errichtet wird (§ 2232 BGB). Der Erblasser erläutert seinen Willen gegenüber dem Notar, welcher diesen dann protokolliert. Erheblicher Vorteil dieser Form der Testamentserrichtung ist vor allem, dass der Notar regelmäßig Formulierungen wählen wird, welche den Willen des Erblassers tatsächlich abbilden. Zudem kann ein öffentliches Testament meist einen Erbschein vollständig ersetzen und spart dem Erben insofern die hierfür anfallenden Kosten.
Zu beachten ist jedoch auch beim öffentlichen Testament, dass der Notar zwar dafür Sorge tragen wird, dass das Testament dem Willen des Erblassers entspricht, die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und damit einhergehende Optimierung der Testamentsgestaltung für den konkreten Fall wird der Notar allerdings nicht untersuchen. Hierfür wäre ein spezialisierter Rechtsanwalt (auch Fachanwalt für Erbrecht) der richtige Ansprechpartner.
Besondere Situationen können dazu führen, dass die sonst übliche Form der Testamentserrichtung nicht mehr möglich ist. Hierfür kommen ausnahmsweise das Bürgermeistertestament (§ 2249 BGB), das Drei-Zeugen-Testament (§2250 BGB) und das Seetestament (§2251 BGB) in Betracht. Diese, auch Nottestamente genannten Formen, haben heute kaum noch eine praktische Bedeutung. Insbesondere ist zu beachten, dass sie in der Regel ihre Wirkung verlieren, wenn der Erblasser nach seiner Errichtung weitere drei Monate lebt und in dieser Zeit noch imstande war, ein ordentliches Testament zu errichten.
Ausnahmsweise dann, wenn einer Person die eigenhändige Errichtung eines Testaments deswegen unmöglich ist, weil sie schreibunkundig (Analphabet) oder schreibunfähig (z.B. durch Erkrankung oder körperliche Beeinträchtigungen) ist, verbleibt für diese Personen nur die Möglichkeit einer öffentlichen Errichtung zur Niederschrift vor einem Notar oder Übergabe einer Schrift an diesen.
Ehegatten und eingetragene Lebenspartner können ein gemeinschaftliches Testament errichten (§ 2265 BGB). Vorgenannten Personengruppen ist neben der notariellen Errichtung auch die schriftliche eigenhändige Anfertigung eines Testaments durch nur einen der beiden Partner und anschließende Unterzeichnung durch den jeweils anderen Partner gestattet.
Sofern ein Testament in dieser Form errichtet wird, entsteht hinsichtlich wechselbezüglich getroffener Anordnungen bei Tod des einen Teils eine Bindungswirkung für den Überlebenden. Bis zum Versterben des einen Teils kann jedoch auch das gemeinschaftliche Testament, unabhängig von der Frage, ob die jeweils getroffenen Anordnungen wechselbezüglich sind oder nicht, jederzeit widerrufen werden. Hier ist allerdings zu beachten, dass der Widerruf notariell zu erfolgen hat und insofern erst wirksam wird, wenn die entsprechende Widerrufserklärung dem jeweils anderen Teil zugegangen ist.
Um sicherzustellen, dass ein Testament nach dem Tod auch aufgefunden wird und nicht bewusst oder versehentlich „verschwindet“, ist es möglich, ein Testament in amtliche Verwahrung an das Nachlassgericht zu übersenden. Während dieses Vorgehen bei der Errichtung eines öffentlichen Testaments vor einem Notar von diesem automatisch veranlasst wird, muss der eigenhändig Testierende dies gesondert veranlassen.
Sobald dem Nachlassgericht ein so übersandtes Testament zugeleitet oder vor einem Notar ein Testament errichtet wurde, wird dies seit 01. Januar 2012 an das von der Bundesnotarkammer errichtete und als Körperschaft des öffentlichen Rechts geführte Zentrale Testamentsregister (ZTR) übersandt.
Inzwischen ist die Einrichtung einer automatisierten elektronischen Übermittlung von Sterbefällen an das ZTR in Arbeit, so dass in naher Zukunft an einem Erbfall beteiligte Personen einfach und zeitnah informiert werden können.
Der Widerruf eines Testaments ist jederzeit möglich. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können ein Widerrufstestament errichten (§ 2254 BGB), das eigenhändige Testament vernichten bzw. verändern (§ 2255 BGB) oder ein neues Testament mit anderen Verfügungen errichten (§ 2258 BGB). Es empfiehlt sich insofern, Testamenten voranzustellen, ob das zeitlich zuvor errichtete Testament vollständig widerrufen werden soll oder nicht.
Eine weitere Möglichkeit für den Widerruf eines öffentlichen Testaments besteht in seiner Rücknahme aus der amtlichen Verwahrung (§ 2256 BGB). Dabei ist zu beachten, dass die vom Testierenden verlangte Rücknahme eines öffentlichen Testaments (anders beim eigenhändigen Testament) aus der amtlichen Verwahrung selbst dann als Widerruf gilt, wenn dies nicht beabsichtigt ist.
Eine große Besonderheit ergibt sich bei der Auslegung von Testamenten. Idealerweise sollte ein Testament so verfasst sein, dass der sich darin befindliche Wille des Erblassers vom Testamentsempfänger auch genauso verstanden wird.
Während im täglichen Leben oft Erklärungen gegenüber einem anderen abgegeben werden, solche Erklärungen also empfangsbedürftig sind, kommt es dabei weniger darauf an, was ein Erklärender wohl gemeint haben könnte, sondern vielmehr, wie der Empfänger diese Erklärung üblicherweise verstehen durfte. Dabei wird darauf abgestellt, was ein objektiver (fiktiver) Dritter vernünftiger Weise verstanden hätte (objektiver Empfängerhorizont).
Anders verhält sich dies bei der Auslegung von Testamenten. Diese stellen eine nur einseitige Willenserklärung, nämlich die des Testierenden, dar. Aus diesem Grund wird schnell klar, dass es für die Auslegung eines Testaments ausschließlich darauf ankommen kann, was der Testierende wohl gemeint haben mag. Es kann also durchaus vorkommen, dass ein Testament einen wörtlichen Inhalt besitzt, der überhaupt nicht mit dem vom Erblasser Gewollten übereinstimmt. Lässt sich dieser Umstand beweisen, kann es also trotz eines augenscheinlich klaren Testamentsinhalts im Rahmen der Erbauseinandersetzung zu gänzlich unerwarteten Ergebnissen kommen.
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass ein eigenhändig geschriebenes Testament ein erhebliches Streitpotential bieten kann. Zwar kann auch ein vor einem Notar errichtetes Testament einen abweichenden Erblasserwillen beinhalten. Da es aber gerade die Aufgabe des Notars ist, klare und rechtssichere Formulierungen zu wählen, wird die Behauptung, ein öffentliches Testament entspräche nicht dem tatsächlichen Willen des Erblassers, schwer zu beweisen sein.
Eine Testamentsanfechtung muss nicht voraussetzen, dass der Erblasser bewusst bestimmte Personen unberücksichtigt gelassen hat. Der Erblasser kann aufgrund seiner Unkenntnis schlicht berechtigte Erben oder auch Pflichtteilsberechtige übersehen haben. Es können aber auch durch Zeitablauf geänderte Umstände eingetreten sein, welche eine Testamentsanfechtung rechtfertigen.
Zur Testamentsanfechtung sind generell alle Personen berechtigt, die im Erfolgsfall einen Nutzen davon hätten. Naturgemäß sind das der Erb- und Pflichtteilsberechtigte, aber auch Vor- und Ersatzerben.
Die Anfechtungserklärung kann beim zuständigen Nachlassgericht des letzten Wohnortes des Erblassers eingereicht werden. Dies muss innerhalb eines Jahres ab Kenntnis über den Anfechtungsgrund erfolgen. Nach 30 Jahren sind jegliche erbrechtliche Ansprüche verjährt und das Testament kann nicht mehr angefochten werden.
Bei einer Testamentsanfechtung können abhängig vom Nachlasswert Anwalts- und Gerichtskosten entstehen. Diese Kosten sind unter Umständen durch Ihre Rechtsschutzversicherung abgedeckt. Bei einer erfolgreichen Anfechtung werden die etwaige Kosten vom Nachlass abgezogen.
Wird der Erblasser über Tatbestände nicht oder absichtlich falsch informiert, auf deren Basis er testamentarische Entscheidungen trifft, spricht man von arglistiger Täuschung, aufgrund dessen das Testament angefochten werden kann.
Auch wenn ein Testament unter Drohungen zustande kam, kann es angefochten werden. Das Testament darf nicht unter sittenwidrigen Umständen zustande gekommen sein. Dies ist z.B. der Fall, wenn sich der Erblasser in einer körperlichen oder psychischen Zwangslage befand, so dass er seinen Willen nicht frei formulieren konnte.
Ein im Erbrecht ausnahmsweise beachtlicher Motivirrtum liegt vor, wenn der Erblasser sich z.B. über die Zusammensetzung oder den Bestand des Nachlasses geirrt hat.
Von einem Inhaltsirrtum spricht man, wenn der Erblasser schlicht aus Unkenntnis, z.B. über die gesetzliche Erbrechtsfolge, Testamentsentscheidungen getroffen hat, die nicht in seinem Sinne waren und bei deren Kenntnis er anders entschieden hätte.
Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn sich im Testament einfach verschrieben wurde und die „Erklärung“ im Testament vom eigentlichen Erblasserwillen abweicht.
können u.a. eine Testierunfähigkeit des Erblassers, die Bindung des Erblassers an frühere Erbverträge oder Testamente oder die Nichtbeachtung eines Pflichtteilsberechtigten sein.
Nicht die Frage nach persönlich empfundener Gerechtigkeit der Testamentsaussage ist also ausschlagend für eine Testamentsanfechtung, sondern das Vorliegen beweisbarer und fundierter Gründe.
Wenn die Anfechtung erfolgreich ist, sind die betroffenen Verfügungen unwirksam. Dabei ist zu beachten, dass das gesamte Testament nur dann unwirksam wird, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser die übrigen Verfügungen ohne die angefochtenen nicht getroffen hätte (§ 2085 BGB). In diesem Fall findet die gesetzliche Erbfolge Anwendung.
Nach dem Testament ist der Erbvertrag die zweite Möglichkeit für den Erblasser, durch eine Verfügung von Todes wegen von der gesetzlichen Erbfolge abzuweichen. Auch mit dem Erbvertrag kann er Entscheidungen über sein Vermögen für die Zeit nach seinem Tod treffen.
Sowohl das Testament als auch der Erbvertrag fallen unter die Begrifflichkeit der „Verfügung von Todes wegen“. Im Unterschied zum Testament binden sich beim Erbvertrag der Erblasser und sein Vertragspartner. So gewinnt der bedachte Erbe als Vertragspartner eine größere Sicherheit durch seine Anwartschaft. Dieser Vertrag lässt sich nicht ohne Weiteres aufheben, ein Testament dagegen kann der Erblasser schnell widerrufen.
In der Praxis wird der Erbvertrag häufig mit anderen Vereinbarungen, welche nicht direkt mit dem Erbe zusammenhängen, kombiniert. Das bietet sich z.B. bei Grundstücksübertragungen und Unternehmensnachfolgen an oder im sogenannten „Ehe- und Erbvertrag“.
Der Erbvertrag muss bei gleichzeitiger Anwesenheit aller Vertragspartner vor einem Notar geschlossen werden (§ 2276 BGB). Der Erblasser muss dabei testier- und geschäftsfähig sein.
Ein Erbvertrag eröffnet mehreren Vertragspartnern die Möglichkeit, letztwillige Verfügungen zu treffen. Diese können einseitig (z.B. Testamentsvollstreckung) oder gegenüber den anderen Vertragspartnern (z.B. Erbeinsetzung) wirken.
Der Erbvertrag bindet den Erblasser. Letztwillige Verfügungen, die zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden und im Widerspruch zu den im Erbvertrag festgelegten Verfügungen stehen, sind unwirksam.
Auch einen Erbvertrag kann man anfechten. Alle vom Erbvertrag Betroffenen sind zur Anfechtung berechtigt.
Bezüglich der Anfechtungsgründe ist auf die Ausführungen zur Anfechtung von Testamenten zu verweisen (§ 2281 BGB i.V.m. §§ 2078, 2079 BGB).
Der Erblasser muss seine Anfechtungserklärung persönlich beim Notar beurkunden lassen (§ 2282 BGB). Die Anfechtungserklärung muss gegenüber dem Vertragspartner abgegeben werden, sollte dieser vorverstorben sein, ist die Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht abzugeben. Ficht der Erblasser selbst den Erbvertrag erfolgreich an, so kann er seine Erbfolge neu regeln.
Andere Anfechtungsberechtigte müssen den Erbvertrag immer gegenüber dem Nachlassgericht anfechten (§ 2081 BGB).
Die Anfechtung muss innerhalb eines Jahres ab Kenntnisnahme des Anfechtungsgrundes erfolgen.
Eine Anfechtung ist für alle vom Erbvertrag Betroffenen ausgeschlossen, wenn der Erblasser einen anfechtbaren Erbvertrag zu Lebzeiten bestätigt hat (§§ 2284, 2285 BGB).
Grundsätzlich folgt das deutsche Erbrecht der sogenannten Gesamtrechtsnachfolge. Dies bedeutet, dass beim Tod eines Menschen sein Vermögen als Ganzes kraft Gesetzes auf einen oder mehrere Erben übergeht (§ 1922 BGB). Der Erblasser kann jede beliebige Person zum Erben berufen. Dabei kann es sich um Verwandte, aber auch um Organisationen, Freunde und Bekannte handeln.
Will der Erblasser von der gesetzlichen Erbfolge abweichen, kann er dies ausschließlich durch eine Erbeinsetzung in einem Testament oder in einem Erbvertrag festlegen. Eine mündliche Willenserklärung genügt nicht. Testament und Erbvertrag bedürfen der schriftlichen Form.
Existieren weder Testament noch Erbvertrag, setzt die gesetzliche Erbfolge ein.
Im Unterschied zur Erbeinsetzung kann der Erblasser mit einem Vermächtnis seinen Nachlass zielgerichtet verteilen. Damit stehen ihm erweiterte Möglichkeiten für die Erbgestaltung zur Verfügung.
Das „Vermächtnis“ fußt auf dem Wortstamm „vermachen“ und das deutsche Erbrecht unterscheidet zwischen Vererben und Vermachen. Beim Vererben ist eine Erbeinsetzung auf einen bestimmten Gegenstand nicht möglich. Deshalb wählt ein Erblasser das Vermächtnis, in welchem er einer bestimmten Person oder Organisation Teile seines Nachlasses „vermachen“ will.
Damit wird der Vermächtnisnehmer nicht zu einem Erben. Somit obliegen ihm auch nicht die damit verbundenen Rechte und Pflichten. Er muss sich also auch nicht mit einer Erbengemeinschaft auseinandersetzen. Mit einem Vermächtnis werden bestimmte Vermögenswerte aus dem Nachlass direkt einer Person oder Organisation zugewiesen, gerade um damit alle Unwägbarkeiten einer Erbauseinandersetzung zu umgehen. Der Bedachte hat damit einen schuldrechtlichen Anspruch auf den Gegenstand des Vermächtnisses, den er gegen die Erbengemeinschaft geltend machen kann.
Die Gestaltung von Vermächtnissen ist vielfältig möglich. Es kann sich um ein Fahrzeug, das Familiengeschirr oder eine Immobilie handeln. Ein klassisches Vermächtnis ist ein festgelegter Geldbetrag.
Vermächtnisse können nicht nur Gegenstände oder Geld betreffen, sondern alles, was man beanspruchen kann. Dies meint nicht nur Sachgegenstände, sondern auch Rechte, wie z.B. Wohn- oder Nutzungsrechte, Mieten oder Renten. Ein Vermächtnis kann an Bedingungen geknüpft oder auch an Fristen gebunden werden.
Mit der Wahl eines Vermächtnisses anstelle der Erbeinsetzung kann der Erblasser Weichen stellen, um der Erbengemeinschaft mögliche Streitpunkte zu ersparen.
Möchte ein Erblasser, dass die Begünstigten eines Nachlasses gewisse Pflichten oder Aufgaben übernehmen, kann er dies mit sogenannten Auflagen im Testament oder im Erbvertrag verankern. Diese sind für die Benannten verpflichtend.
Damit eröffnet sich dem Erblasser die Möglichkeit, ein bestimmtes Verhalten oder definierte Leistungen von seinen Erben oder Vermächtnisnehmern über seinen Todestag hinaus zu bestimmen.
Klassische Auflagen sind Aufgaben in Verbindung mit Zuwendungen an Institutionen. So kann ein Vermächtnis an ein Pflege- oder Tierheim mit bestimmten Auflagen zur Pflege von Angehörigen bzw. einem neuen Heim für die Tiere kombiniert werden.
Auflagen können in vielfältigen Varianten wirken. Sie können die Verwaltung des Nachlasses, z.B. von Immobilien oder einer Firma, betreffen. Sie können Verbote anordnen, Handlungsanweisungen vorgeben oder die Instruktionen an einen Testamentsvollstrecker festlegen. Im Unterschied zum einseitigen Vererben oder Vermachen fordert der Erblasser mit den Auflagen also auch etwas ein.
Wie andere letztwillige Anordnungen müssen auch Auflagen schriftlich verfügt werden. Hierbei kann die Hinzuziehung eines Notars hilfreich sein, da Auflagen (ähnlich einem Vermächtnis) sehr weitreichend und flexibel gestaltet werden können.
Die Erfüllung der Auflagen kann von verschiedenen Personen durchgeführt werden. Da diese nicht vom Beschwerten bestimmt werden sollten, wurden diese vom Gesetz festgelegt. So kommt u.a. der befugte Testamentsvollstrecker oder auch ein Miterbe in Frage.
Um die Erbaufteilung unter mehreren Erben in die beabsichtigten Bahnen zu lenken, kann sich der Erblasser einer Teilungsanordnung bedienen. Dabei geht es nicht um die Aufteilung eines Gegenstandes (wie bei einem Vermächtnis). Die Teilungsanordnung betrifft die Auseinandersetzung des Erbes.
Mit ihr kann der Erblasser entscheiden, wie ein oder mehrere Vermögensgegenstände unter den Miterben aufgeteilt werden sollen. Übersteigt dabei der Wert des zugewendeten Gegenstandes die Erbquote des bedachten Erben, so muss dies den Miterben gegenüber ausgeglichen werden. Letztendlich wird so keiner der Erben bevorzugt.
Sind sich die Erben untereinander einig, können sie die Teilungsanordnung auch umgehen.
Ein Erblasser hat mehrere Möglichkeiten, seine Erbangelegenheiten über seinen Tod hinaus zu beeinflussen. Die Testamentsvollstreckung ist dabei die wirkungsvollste Variante.
Die Schlüsselrolle kommt hierbei dem Testamentsvollstrecker zu. Im Normalfall ist dies eine vom Erblasser bestimmte Person, welche dessen Belange nach seinem Tod durchsetzt, also dafür Sorge trägt, dass die Teilung des Nachlasses und die angeordneten Regelungen im Sinne des Erblassers realisiert werden.
Regelmäßig bestimmt der Erblasser in seinem Testament oder Erbvertrag eine Person, die die Testamentsvollstreckung übernehmen soll.
Eine Verpflichtung zur Übernahme des Amts eines Testamentsvollstreckers besteht nicht, daher muss die vom Erblasser bestimmte Person die Annahme des Amts gegenüber dem Nachlassgericht erklären oder verweigern.
Auf Antrag eines Beteiligten kann der Testamentsvollstrecker entlassen werden, wenn ein wichtiger Grund, z.B. grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung, vorliegt (§ 2227 BGB).
Sofern der Erblasser nicht etwas anderes bestimmt hat, kann der Testamentsvollstrecker eine angemessene Vergütung verlangen (§ 2221 BGB).
Der Testamentsvollstrecker verwaltet den Nachlass wirtschaftlich, bewahrt ihn vor Schaden, kann Außenstände einfordern und Auflagen überwachen.Gerade bei zerstrittenen und zerstreuten Erbengemeinschaften kommt dem Testamentsvollstrecker eine schlichtende, lenkende und schützende Position zu.
Er ist auch für die Abgabe der Erbschaftssteuererklärung (§ 31 Abs. 5 ErbStG) und die Begleichung der Erbschaftssteuer (§ 32 Abs. 1 ErbStG) verantwortlich.
Entsprechend der jeweiligen Aufgabenstellung werden verschiedene Arten der Testamentsvollstreckung unterschieden. Die beiden häufigsten Arten sind die Auseinandersetzungsvollstreckung (§§ 2203, 2204 BGB) und die Verwaltungsvollstreckung (§ 2209 Satz 1, Hs.1. BGB).
Die Auseinandersetzungsvollstreckung ist die gängigste Form der Testamentsvollstreckung. In einer Erbengemeinschaft mit all ihren Interessen und den möglichen Reibungspunkten hat der Testamentsvollstrecker die Aufgabe, den Nachlass zu schützen, aufzuteilen und für die Einhaltung möglicher Anordnungen im Sinne des Erblassers Sorge zu tragen.
Er ist dafür verantwortlich, dass die vom Erblasser ggf. getroffenen Anordnungen, wie Vermächtnisse, Auflagen und Teilungsanordnungen, zeitnah durchgesetzt werden. Die Erben sind dabei nicht berechtigt, dem Testamentsvollstrecker Weisungen zu erteilen.
Die Arbeit des Testamentsvollstreckers endet nach dem Abschluss der Erbauseinandersetzung, der völligen Aufteilung des Nachlasses und dem Bezahlen der Erbschaftssteuer.
Bei der Verwaltungsvollstreckung geht es vorrangig um die Verwaltung des Nachlassvermögens. Sie unterliegt dem verantwortlichen Testamentsvollstrecker, der den Nachlass im Sinne des Erblassers erhalten, schützen und mehren soll. Dies ist sinnvoll, wenn das Erbe beispielsweise eine Firma enthält, deren Betrieb nach dem Willen des Erblassers fortgeführt werden soll.
Ein anderer wichtiger Grund für eine Verwaltungsvollstreckung ist die Wahrung der Interessen minderjähriger Erben. Hier entscheidet der Testamentsvollstrecker anstelle der unerfahrenen Minderjährigen, die letzten Endes auch vor sich selbst geschützt werden sollen. Es ist üblich, die Verwaltungsvollstreckung zu befristen, z.B. bis zum Erreichen der Volljährigkeit.
Für einen ausführlichen Fahrplan nach dem Erbfall schauen Sie bitte unter
Wenn Sie Ihren Erbteil anbieten möchten, können Sie das über unser Formular tun. Schnell, sicher und unverbindlich.
Institut für Erbteilung
und Erbauseinandersetzung
Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.